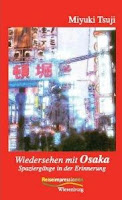Willkommen in dem recht wilden Beziehungsgeflecht in Kikujis Familie. Kikujis Vater hat zu seinen Lebzeiten nichts anbrennen lassen. Zeitweise hatte er eine außereheliche Affäre mit der eher burschikosen Zeremonienmeisterin Chikako, bei der er die Teezeremonie erlernte. Doch als Frau Oota verwitwete, war er mehr von deren fraulicher Sanftheit angetan und tauschte die Geliebte Chikako gegen Frau Oota aus. Nichtsdestotrotz ging Chikako im Haushalt des Vaters ein und aus und der Mutter zur Hand. Die Affären des Vaters waren ein offenes Geheimnis.
Jahre nach dem Tod der Eltern nimmt Kikuji eine Einladung Chikakos zur Teezeremonie an. Sie will ihn mit der hübschen Yukiko verkuppeln. Doch wie’s der Teufel will, ist genau an diesem Tag auch Frau Oota mit ihrer Tochter Fumiko ebenfalls zugegen. Zwar hat sich Kikuji schon in Yukiko verguckt, doch zieht ihn die sanfte Frau Oota wie magisch an. Die Grenzen beginnen zu verschwimmen: Sieht Frau Ooota in Kikuji seinen Vater; fühlt sich Kikuji wie sein Vater, wenn er intim mit Frau Oota wird?
Die Liaison bleibt von der intriganten Chikako nicht unentdeckt. Frau Oota fühlt sich schuldig und setzt ihrem Leben ein Ende. Für Kikuji nimmt nun deren Tochter Fumiko, ein Abbild der Mutter, deren Platz ein. Doch während Frau Oota einem traditionellen Frauenbild entspricht, sieht Fumiko die Ehe nicht als Versorgungsgemeinschaft; sie beginnt auf eigenen Füßen zu stehen. Und so wird Yasunari Kawabatas „Tausend Kraniche“ auch ein Zeugnis der Modernisierung der Frauenrolle.
Die Handlung in „Tausend Kraniche“ ist von einer trägen Dynamik. Viel wird nur angedeutet, metaphorisiert, ästhetisiert und in einen Gesamtzusammenhang eingebaut, der dem Europäer befremdlich anmutet. Wer sich auf den Roman einlässt, wird aber sicherlich auf seine Kosten kommen.
Bibliographische Angaben:
Kawabata, Yasunari: „Tausend Kraniche“, dtv, München 1989, ISBN 3-423-11080-5
Freitag, 30. November 2012
Sonntag, 25. November 2012
„So etwas wie eine Autobiographie“ von Akira Kurosawa
Im Vorwort zu „So etwas wie eine Autobiographie“ gibt Akira Kurosawa an, er habe sich ursprünglich gegen das Verfassen einer Autobiographie gewehrt. Denn zöge man das Kino von ihm ab, bliebe nichts übrig, über das man berichten könne. Doch nach der Lektüre von Jean Renoirs-Autobiographie habe er seine Meinung geändert: Jeder Mensch wird aus den vielen Begegnungen geformt; das Individuum entsteht aus diversen Elementen, die seine Entwicklung begleiten. Diesen Begegnungen widmet Akira Kurosawa seine Quasi-Autobiographie:
Da sind natürlich seine Eltern: Der Vater, der eine Militärakademie absolvierte und schließlich selbst an einer Militärschule unterrichtete, legte Maßstäbe eines Samurais an die Söhne an. Umso unverständlicher war für ihn, dass der kleine Akira lieber Mädchenspiele mit den Schwestern spielte, als sich mit Jungs auszutoben. Die Mutter wirkte dagegen mehr wie ein stoischer Ruhepol in der Familie. Mit seinem älteren Bruder Heigo verband Akira Kurosawa eine enge Bindung: In seinen 20ern lebte Akira Kurosawa einige Zeit in Heigos Haushalt und Heigo, der sich als Stummfilmerzähler verdingte, begeisterte Akira Kurosawa für das Medium Film. Umso schlimmer wog der Selbstmord des Bruders: Mit 27 nahm er sich in einem Gasthaus auf der Halbinsel Izu das Leben – da die Menschen, sobald sie das Alter von 30 Jahren überschritten, ohnehin nur hässlicher und gemeiner würden.
Der Leser erfährt auch, dass der kleine Akira als Schüler als Heulsuse verschrien war. Mit der zweiten Heulsuse des Schuljahrgangs, Uekusa, freundete sich Akira Kurosawa an. Später sollte Uekusa ebenfalls Drehbücher schreiben und Akira Kurosawas Lebensweg erneut und mehrfach kreuzen. Dank des fortschrittlich denkenden Lehrers Tachikawa wurden die beiden schwächlichen Schüler dennoch gefördert.
1928 begann sich Akira Kurosawa für die proletarische Kunst zu interessieren; 1929 trat er in die Liga der proletarischen Künstler ein. Die dem Naturalismus verhaftete Bewegung konnte Akira Kurosawa jedoch nicht langfristig binden; er ging für die proletarische Presse in den Untergrund. Dennoch konnte er sich nicht zum Kommunismus bekennen:
Im Zusammenhang mit seinem Engagement für die proletarische Bewegung hatte er selbstverständlich auch einige unangenehme Begegnungen mit der Polizei. Eine schwere Krankheit war der Anlass für seinen Ausstieg.
Nach dem Tod seines Bruders bewarb sich Akira Kurosawa als Regieassistent bei den P.C.L.-Studios. Zunächst war er alles andere als begeistert von seinen Aufgaben und wollte bereits hinschmeißen. Doch insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Kajiro Yamamoto wurde Akira Kurosawas Lehrzeit eine besonders fruchtbare. Schließlich war es soweit, dass Akira Kurosawa mit „Sugata Sanshiro“ seinen ersten eigenen Film drehen durfte. Anlässlich der Fertigstellung hatte er auch seine erste unliebsame Begegnung mit der japanischen Zensur.
„So etwas wie eine Autobiographie“ endet mit dem Abdrehen von „Rashomon“, für den Akira Kurosawa mit dem Goldenen Bären der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet wurde und sich international etablieren konnte. Nicht nur „Rashomon“, sondern auch seinen anderen Filmen, die er bis 1950 drehte, widmet er ein Kapitel. So erhält der Leser einen kleinen Einblick in die jeweiligen Schaffensphasen.
„So etwas wie eine Autobiographie“ liest sich flüssig und ist aufgrund vieler Anekdoten sehr kurzweilig. Sicherlich werden Filmfans besonders auf ihre Kosten kommen, doch auch ohne ein Akira Kurosawa-Anhänger zu sein, macht die Lektüre Spaß. Durch die Gedanken zu Heigos Selbstmord, zur Zensur, zu Streiks und zur japanischen Gesellschaft enthält „So etwas wie eine Autobiographie“ aber auch ernstere Themen.
Bibliographische Angaben:
Kurosawa, Akira: „So etwas wie eine Autobiographie“, Schirmer/Mosel, München 1986, ISBN 3-88814-201-6
Da sind natürlich seine Eltern: Der Vater, der eine Militärakademie absolvierte und schließlich selbst an einer Militärschule unterrichtete, legte Maßstäbe eines Samurais an die Söhne an. Umso unverständlicher war für ihn, dass der kleine Akira lieber Mädchenspiele mit den Schwestern spielte, als sich mit Jungs auszutoben. Die Mutter wirkte dagegen mehr wie ein stoischer Ruhepol in der Familie. Mit seinem älteren Bruder Heigo verband Akira Kurosawa eine enge Bindung: In seinen 20ern lebte Akira Kurosawa einige Zeit in Heigos Haushalt und Heigo, der sich als Stummfilmerzähler verdingte, begeisterte Akira Kurosawa für das Medium Film. Umso schlimmer wog der Selbstmord des Bruders: Mit 27 nahm er sich in einem Gasthaus auf der Halbinsel Izu das Leben – da die Menschen, sobald sie das Alter von 30 Jahren überschritten, ohnehin nur hässlicher und gemeiner würden.
Der Leser erfährt auch, dass der kleine Akira als Schüler als Heulsuse verschrien war. Mit der zweiten Heulsuse des Schuljahrgangs, Uekusa, freundete sich Akira Kurosawa an. Später sollte Uekusa ebenfalls Drehbücher schreiben und Akira Kurosawas Lebensweg erneut und mehrfach kreuzen. Dank des fortschrittlich denkenden Lehrers Tachikawa wurden die beiden schwächlichen Schüler dennoch gefördert.
1928 begann sich Akira Kurosawa für die proletarische Kunst zu interessieren; 1929 trat er in die Liga der proletarischen Künstler ein. Die dem Naturalismus verhaftete Bewegung konnte Akira Kurosawa jedoch nicht langfristig binden; er ging für die proletarische Presse in den Untergrund. Dennoch konnte er sich nicht zum Kommunismus bekennen:
„Eigentlich empfand ich nur die vage Unzufriedenheit und Abneigung, die mir die japanische Gesellschaft einflößte, und um mit diesem Gefühl fertig zu werden, schloss ich mich der radikalsten Bewegung an, die ich finden konnte. Aus heutiger Sicht erscheint mir mein damaliges Verhalten reichlich frivol und leichtsinnig.“ (S. 96 f.)
Im Zusammenhang mit seinem Engagement für die proletarische Bewegung hatte er selbstverständlich auch einige unangenehme Begegnungen mit der Polizei. Eine schwere Krankheit war der Anlass für seinen Ausstieg.
Nach dem Tod seines Bruders bewarb sich Akira Kurosawa als Regieassistent bei den P.C.L.-Studios. Zunächst war er alles andere als begeistert von seinen Aufgaben und wollte bereits hinschmeißen. Doch insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Kajiro Yamamoto wurde Akira Kurosawas Lehrzeit eine besonders fruchtbare. Schließlich war es soweit, dass Akira Kurosawa mit „Sugata Sanshiro“ seinen ersten eigenen Film drehen durfte. Anlässlich der Fertigstellung hatte er auch seine erste unliebsame Begegnung mit der japanischen Zensur.
„So etwas wie eine Autobiographie“ endet mit dem Abdrehen von „Rashomon“, für den Akira Kurosawa mit dem Goldenen Bären der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet wurde und sich international etablieren konnte. Nicht nur „Rashomon“, sondern auch seinen anderen Filmen, die er bis 1950 drehte, widmet er ein Kapitel. So erhält der Leser einen kleinen Einblick in die jeweiligen Schaffensphasen.
„So etwas wie eine Autobiographie“ liest sich flüssig und ist aufgrund vieler Anekdoten sehr kurzweilig. Sicherlich werden Filmfans besonders auf ihre Kosten kommen, doch auch ohne ein Akira Kurosawa-Anhänger zu sein, macht die Lektüre Spaß. Durch die Gedanken zu Heigos Selbstmord, zur Zensur, zu Streiks und zur japanischen Gesellschaft enthält „So etwas wie eine Autobiographie“ aber auch ernstere Themen.
Bibliographische Angaben:
Kurosawa, Akira: „So etwas wie eine Autobiographie“, Schirmer/Mosel, München 1986, ISBN 3-88814-201-6
Samstag, 24. November 2012
Akira Kurosawa
In erster Linie gilt Akira Kurosawa als DER japanische Regisseur. 1910 wurde er in Tokio als jüngster Sohn in eine kinderreiche Familie geboren. Schon früh interessierte sich Akira Kurosawa für Malerei. 1927 trat er in eine private Kunstschule ein. Da er von seiner Malerei jedoch nicht leben konnte, bewarb sich Akira Kurosawa um eine Stelle als Regieassistent. Die Begeisterung für Filme hatte sein älterer Bruder Heigo in ihm entfacht, der als Stummfilmerzähler gearbeitet hatte. 1943 führte Akira Kurosawa erstmals selbst Regie.
International bekannt wurde Akira Kurosawa, als er 1951 für die Verfilmung von Ryunosuke Akutagawas „Rashomon“ auf den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. 1952 erhielt „Rashomon“ einen Oscar als bester ausländischer Film.
1998 starb Akira Kurosawa an einem Hirnschlag. Er schrieb unzählige Drehbücher und führte bei über 30 Filmen Regie.
Interessante Links:
Ins Deutsche übersetzte Werke und hier rezensiert:
International bekannt wurde Akira Kurosawa, als er 1951 für die Verfilmung von Ryunosuke Akutagawas „Rashomon“ auf den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. 1952 erhielt „Rashomon“ einen Oscar als bester ausländischer Film.
1998 starb Akira Kurosawa an einem Hirnschlag. Er schrieb unzählige Drehbücher und führte bei über 30 Filmen Regie.
Interessante Links:
- Japankino: Der Krieger und die Kamera
- Kinema: Interview mit Akira Kurosawa über den Film „Madadayo“ – einen Film über den Autor Hyakken Uchida
- Senses of Cinema: Akira Kurosawa
- Illustrated Japanese Vocabulary: Diverse Filmtrailer
Ins Deutsche übersetzte Werke und hier rezensiert:
Freitag, 23. November 2012
„Verdächtige Geliebte“ von Keigo Higashino
Keigo Higashinos „Verdächtige Geliebte“ ist eine positive Überraschung in diesem Leseherbst. Bisher war nur der recht dröge Krimi „Mord am See“ des Autors in deutscher Übersetzung zu lesen. Die zweite Übersetzung des Edogawa Rampo-Preisträgers fesselt bis zur allerletzten Seite und ist ein Page-Turner bester Güte.
Worum geht’s? Der eigenbrödlerische Lehrer Ishigami ist ein gescheitertes Mathematik-Genie. Neben dem Lösen von schwierigen mathematischen Fragestellungen ist seine einzige Freude im Leben, sich sein Lunchpaket im Bentoladen zu kaufen, in dem seine Nachbarin Yasuko arbeitet. Ishigami ist verliebt in die allein erziehende Mutter. Yasuko hatte bisher Pech mit den Männern. Vom Vater ihrer Tochter lebt sie getrennt. Und auch ihre zweite Ehe ging in die Brüche – doch ihr Ex-Ehemann terrorisiert Yasuko, will Geld aus ihr herauspressen. Als er eines Tages wieder einmal vor der Tür steht und gierig Geld verlangt, geschieht das Unfassbare: Yasuko tötet ihren Ex-Mann im Affekt, als dieser auf die Tochter losgeht. Völlig unversehens bietet Ishigami seine Hilfe an, den Mord zu vertuschen. Der Mathematiker scheint in Windeseile einen wasserdichten Plan zu schmieden.
Der Mord bleibt nicht lange unentdeckt. Doch an Yasukos Alibi, das ihr Ishigami besorgt hat, ist kaum zu rütteln. Wenn die Polizei jedoch nicht unversehens Unterstützung von Ishigamis ehemaligem Kommilitonen, dem Physiker Yukawa erhalten würde, wäre der Fall vielleicht ungelöst zu den Akten gelegt worden. Doch Ishigami und Yukawa können sich gegenseitig das Wasser reichen, was ihre analytischen Fähigkeiten betrifft – kann der eine das Labyrinth, das der andere baut, auflösen?
„Verdächtige Geliebte“ spielt mit ähnlichen Zutaten wie Natsuo Kirinos „Die Umarmung des Todes“: Eine hilflose Ehefrau bringt unter widrigen Umständen den (Ex-)Ehemann um die Ecke, will sich der Polizei nicht stellen und nimmt stattdessen die Hilfe von Bekannten in Anspruch, um die Leiche zu entsorgen. Während jedoch Natsuo Kirino die Handlungen aller Beteiligten offen legt, zeichnet sich „Verdächtige Geliebte“ dadurch aus, dass der Leser ebenso wie Yukawa den dünnen Faden aufnehmen muss, der zur Lösung des Falles führen kann – denn die Geschehnisse sind verzwickter, als man glaubt.
Ebenso verzwickt sind die Gefühle, die man als Leser der Figur des Ishigami entgegen bringt. Man schwankt zwischen Sympathie, Mitleid und Abscheu – wahrlich ein ungewöhnlicher Held!
Bibliographische Angaben:
Higashino, Keigo: „Verdächtige Geliebte", Klett-Cotta, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-608-93966-8
Worum geht’s? Der eigenbrödlerische Lehrer Ishigami ist ein gescheitertes Mathematik-Genie. Neben dem Lösen von schwierigen mathematischen Fragestellungen ist seine einzige Freude im Leben, sich sein Lunchpaket im Bentoladen zu kaufen, in dem seine Nachbarin Yasuko arbeitet. Ishigami ist verliebt in die allein erziehende Mutter. Yasuko hatte bisher Pech mit den Männern. Vom Vater ihrer Tochter lebt sie getrennt. Und auch ihre zweite Ehe ging in die Brüche – doch ihr Ex-Ehemann terrorisiert Yasuko, will Geld aus ihr herauspressen. Als er eines Tages wieder einmal vor der Tür steht und gierig Geld verlangt, geschieht das Unfassbare: Yasuko tötet ihren Ex-Mann im Affekt, als dieser auf die Tochter losgeht. Völlig unversehens bietet Ishigami seine Hilfe an, den Mord zu vertuschen. Der Mathematiker scheint in Windeseile einen wasserdichten Plan zu schmieden.
Der Mord bleibt nicht lange unentdeckt. Doch an Yasukos Alibi, das ihr Ishigami besorgt hat, ist kaum zu rütteln. Wenn die Polizei jedoch nicht unversehens Unterstützung von Ishigamis ehemaligem Kommilitonen, dem Physiker Yukawa erhalten würde, wäre der Fall vielleicht ungelöst zu den Akten gelegt worden. Doch Ishigami und Yukawa können sich gegenseitig das Wasser reichen, was ihre analytischen Fähigkeiten betrifft – kann der eine das Labyrinth, das der andere baut, auflösen?
„Verdächtige Geliebte“ spielt mit ähnlichen Zutaten wie Natsuo Kirinos „Die Umarmung des Todes“: Eine hilflose Ehefrau bringt unter widrigen Umständen den (Ex-)Ehemann um die Ecke, will sich der Polizei nicht stellen und nimmt stattdessen die Hilfe von Bekannten in Anspruch, um die Leiche zu entsorgen. Während jedoch Natsuo Kirino die Handlungen aller Beteiligten offen legt, zeichnet sich „Verdächtige Geliebte“ dadurch aus, dass der Leser ebenso wie Yukawa den dünnen Faden aufnehmen muss, der zur Lösung des Falles führen kann – denn die Geschehnisse sind verzwickter, als man glaubt.
Ebenso verzwickt sind die Gefühle, die man als Leser der Figur des Ishigami entgegen bringt. Man schwankt zwischen Sympathie, Mitleid und Abscheu – wahrlich ein ungewöhnlicher Held!
Bibliographische Angaben:
Higashino, Keigo: „Verdächtige Geliebte", Klett-Cotta, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-608-93966-8
Samstag, 17. November 2012
„Der Fälscher“ von Yasushi Inoue
„Der Fälscher“ enthält vier Erzählungen Yasushi Inoues, geprägt von leisem Ton und der Tragik zwischenmenschlicher Beziehungen.
„Der Fälscher“ handelt vom Scheitern des Hara Hosen. Eigentlich ein guter Maler entdeckt er am Werk des Künstlers Onuki seine eigene Unperfektion. Und verlegt sich aufs Fälschen von Onukis Bildern anstatt selbst originäre Kunstwerke zu schaffen. Doch lange kann er seine Machenschaften nicht geheim halten. Als er auffliegt, beginnt er die Herstellung von illegalen Feuerwerkskörpern. Der Lebensweg des Hara Hosen wird von dem dem Ich-Erzähler und Journalisten nach verfolgt, der eigentlich beauftragt worden ist, Onukis Biographie zu verfassen. Das tragische Schicksal des Hara Hosen fesselt ihn weit mehr, als die glänzende Karriere des etablierten Malers:
„Der Vulkan“ steht kurz vor dem Ausbruch. Trotzdem begibt sich ein Landvermesser mit seiner Truppe in die gefährliche Gegend. Unterwegs trifft die Gruppe auf ein Pärchen, das wohl auf dem Weg ist, in den Doppelselbstmord aus Liebe zu gehen. Die Naturkatastrophe wird zahlreiche Opfer finden.
Um Kindheitserinnerungen geht es in „Schilf“. Langsam kommt der Erzähler seiner jung verstorbenen Tante, dem schwarzen Schaf der Familie, näher, indem er Erinnerungsfetzen zu rekonstruieren sucht. Und so kommt er der Tante und der Tragik ihres Lebens näher.
Der Tod von zwei Tieren steht wie eine Metapher für die Beziehung von Kitora und seiner Cousine Ritsuko in der Erzählung „Die Singdrossel“. Kitora tötet einen Fisch auf archaische Weise – bevor er mit seiner Cousine schläft. Und Ritsuko gibt einer Singdrossel im Todeskampf den Gnadenstoß – und beendet damit die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Beziehung.
Wer spannende Handlung liebt, der sollte die Finger von Yasushi Inoues „Der Fälscher“ lassen. Die Erzählungen sind nachdenklich, teilweise analytisch, oftmals mit Metaphern gespickt. Yasushi Inoue, der als Meister der Darstellung von menschlichen Beziehungen gilt, zeichnet mit den Geschichten in „Der Fälscher“ auf verschiedenste Weise tragische Schicksale auf.
Bibliographische Angaben:
Inoue, Yasushi: „Der Fälscher“, Insel, Frankfurt am Main/Leipzig, 1999, ISBN 3-458-16941-5
„Der Fälscher“ handelt vom Scheitern des Hara Hosen. Eigentlich ein guter Maler entdeckt er am Werk des Künstlers Onuki seine eigene Unperfektion. Und verlegt sich aufs Fälschen von Onukis Bildern anstatt selbst originäre Kunstwerke zu schaffen. Doch lange kann er seine Machenschaften nicht geheim halten. Als er auffliegt, beginnt er die Herstellung von illegalen Feuerwerkskörpern. Der Lebensweg des Hara Hosen wird von dem dem Ich-Erzähler und Journalisten nach verfolgt, der eigentlich beauftragt worden ist, Onukis Biographie zu verfassen. Das tragische Schicksal des Hara Hosen fesselt ihn weit mehr, als die glänzende Karriere des etablierten Malers:
„ich sah darin die Tragik des Lebens eines durchschnittlichen Menschen, der durch den Kontakt mit einem Genie von dessen Gewicht erdrückt wurde und sich selbst verzehrt hat.“ (S. 119)
„Der Vulkan“ steht kurz vor dem Ausbruch. Trotzdem begibt sich ein Landvermesser mit seiner Truppe in die gefährliche Gegend. Unterwegs trifft die Gruppe auf ein Pärchen, das wohl auf dem Weg ist, in den Doppelselbstmord aus Liebe zu gehen. Die Naturkatastrophe wird zahlreiche Opfer finden.
Um Kindheitserinnerungen geht es in „Schilf“. Langsam kommt der Erzähler seiner jung verstorbenen Tante, dem schwarzen Schaf der Familie, näher, indem er Erinnerungsfetzen zu rekonstruieren sucht. Und so kommt er der Tante und der Tragik ihres Lebens näher.
Der Tod von zwei Tieren steht wie eine Metapher für die Beziehung von Kitora und seiner Cousine Ritsuko in der Erzählung „Die Singdrossel“. Kitora tötet einen Fisch auf archaische Weise – bevor er mit seiner Cousine schläft. Und Ritsuko gibt einer Singdrossel im Todeskampf den Gnadenstoß – und beendet damit die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Beziehung.
Wer spannende Handlung liebt, der sollte die Finger von Yasushi Inoues „Der Fälscher“ lassen. Die Erzählungen sind nachdenklich, teilweise analytisch, oftmals mit Metaphern gespickt. Yasushi Inoue, der als Meister der Darstellung von menschlichen Beziehungen gilt, zeichnet mit den Geschichten in „Der Fälscher“ auf verschiedenste Weise tragische Schicksale auf.
Bibliographische Angaben:
Inoue, Yasushi: „Der Fälscher“, Insel, Frankfurt am Main/Leipzig, 1999, ISBN 3-458-16941-5
Montag, 12. November 2012
„Das Weib des Yoshiharu“ von Kyoden Santo
Kyoden Santos „Das Weib des Yoshiharu“ wurde 1993 als „Die Geschichte der schönen Sakurahime“ im Insel-Verlag neu aufgelegt. Sowohl das Weib des Yoshiharu (namentlich Frau Nowaki und Mutter der schönen Sakurahime) als auch Sakurahime sind zwei zentrale Gestalten in Kyoden Santos Yomihon, einem Lesebuch, das Geistergeschichten, historische Gegebenheiten, buddhistische Religiosität und einen moralischen Appell an die Leser vermischt. Kyoden Santo schreibt laut dem Originalvorwort eine „Erzählung von Schuld und Sühne“:
Schuld laden viele der Charaktere in „Das Weib des Yoshiharu“ auf sich und zumeist werden sie geläutert. Allerhand Personen werden in die Handlung aufgeführt, die teilweise erst viel später einen zweiten, dritten oder vierten Auftritt haben. Alle Handelnden erscheinen schicksalhaft verknüpft. Da ist beispielsweise der Raufbold Midajiro, der von seinem Herrn, dem Fürsten Yoshiharu, verstoßen wird, nachdem er sich besonders ketzerisch benommen hat. Er erfährt Erleuchtung, als er eine Buddha-Statue aus einem Fluss fischt und mit der Statue im Gepäck auf Pilgerreise geht. Kinitsura, dem die Aufsicht über Yoshiharus schwangere Zeitfrau Tamakoto oblag, begeht als Sühne Selbstmord, als Tamakoto entführt wird. Die Drahtzieherin der Entführung ist niemand anderes als Yoshiharus eifersüchtige und kinderlose Erstfrau, Frau Nowaki. Sie lässt Tamakoto vor der Entbindung töten und lädt gewaltige Schuld auf sich. Als Frau Nowaki doch noch schwanger wird, wird die schöne Sakurahime geboren, die allerhand Männern den Kopf verdreht: Der Mönch Seigen kommt wegen seiner Verliebtheit vom Glauben ab. Der abgewiesene Fürst Heidayu sinnt auf Rache. Und der edle Muneo wird als Verlobter der Schönheit auserkoren. Doch nicht nur Hedayu führt Böses im Schilde – auch Tamakoto hatte in der Stunde ihres Todes Rache geschworen. So nimmt das Schicksal seinen Lauf…
„Das Weib des Yoshiharu“ ist wahrlich ein kleines Epos. Trotz der etwas antiquiert wirkenden Sprache – immerhin datiert das Werk aus dem 18. Jahrhundert und spielt im 13. Jahrhundert – liest sich das Yomihon flüssig und bleibt spannend bis zum Schluss. Sicherlich ein Leckerbissen für Freunde von Historienromanen und Samurai-Literatur.
Bibliographische Angaben:
Santo, Kyoden: „Das Weib des Yoshiharu“, Hermann Klemm/Erich Seemann, Freiburg 1957
Schuld laden viele der Charaktere in „Das Weib des Yoshiharu“ auf sich und zumeist werden sie geläutert. Allerhand Personen werden in die Handlung aufgeführt, die teilweise erst viel später einen zweiten, dritten oder vierten Auftritt haben. Alle Handelnden erscheinen schicksalhaft verknüpft. Da ist beispielsweise der Raufbold Midajiro, der von seinem Herrn, dem Fürsten Yoshiharu, verstoßen wird, nachdem er sich besonders ketzerisch benommen hat. Er erfährt Erleuchtung, als er eine Buddha-Statue aus einem Fluss fischt und mit der Statue im Gepäck auf Pilgerreise geht. Kinitsura, dem die Aufsicht über Yoshiharus schwangere Zeitfrau Tamakoto oblag, begeht als Sühne Selbstmord, als Tamakoto entführt wird. Die Drahtzieherin der Entführung ist niemand anderes als Yoshiharus eifersüchtige und kinderlose Erstfrau, Frau Nowaki. Sie lässt Tamakoto vor der Entbindung töten und lädt gewaltige Schuld auf sich. Als Frau Nowaki doch noch schwanger wird, wird die schöne Sakurahime geboren, die allerhand Männern den Kopf verdreht: Der Mönch Seigen kommt wegen seiner Verliebtheit vom Glauben ab. Der abgewiesene Fürst Heidayu sinnt auf Rache. Und der edle Muneo wird als Verlobter der Schönheit auserkoren. Doch nicht nur Hedayu führt Böses im Schilde – auch Tamakoto hatte in der Stunde ihres Todes Rache geschworen. So nimmt das Schicksal seinen Lauf…
„Das Weib des Yoshiharu“ ist wahrlich ein kleines Epos. Trotz der etwas antiquiert wirkenden Sprache – immerhin datiert das Werk aus dem 18. Jahrhundert und spielt im 13. Jahrhundert – liest sich das Yomihon flüssig und bleibt spannend bis zum Schluss. Sicherlich ein Leckerbissen für Freunde von Historienromanen und Samurai-Literatur.
Bibliographische Angaben:
Santo, Kyoden: „Das Weib des Yoshiharu“, Hermann Klemm/Erich Seemann, Freiburg 1957
Sonntag, 11. November 2012
Kyoden Santo
1761 als Sohn eines Pfandleihers und unter dem bürgerlichen Namen Samuru Iwase geboren, studierte er Ukiyo-e-Malerei bei Shigemasa Kitao. Unter dem Pseudonym Kitao Masanobu illustrierte er seit 1778 Kibyoshi (humorvolle, manchmal auch politisch-satirische, illustrierte Geschichten mit einem Umfang von zehn Seiten). 1782 begann er unter dem Pseudonym Kyoden Santo selbst Kibyoshi zu schreiben. Da seine Familie nach Kyobashi gezogen war, als er dreizehn Jahre war, bezieht sich sein Pseudonym auf diesen Heimatort (Kyo steht für Kyobashi, Santo = östlich der Hügel).
Er schrieb zudem Sharebon (humorvolle Geschichten über die Freudenviertel), eine Literaturgattung die während der Kansei-Reformen verboten wurde. Als Kyoden Santo 1791 drei Sharebon veröffentlichte, wurde er zur Strafe für 50 Tage in Handschellen gelegt. Er verlegte sich im Anschluss mehr auf die Literaturgattung Yomihon (romanhafte, moralisch geprägte Lesebücher, die an historische Gegebenheiten der chinesischen und japanischen Geschichte angelehnt sind; mehr Assemblage als originäre Schöpfung).
Zeitweise führte Kyoden Santo untertags einen Tabakladen, die Nächte streifte er durch Tokios Freudenviertel Yoshiwara. So kaufte er auch seine Lieblingskurtisane frei und nahm sie zur Zweitfrau.
1816 starb der Autor.
Interessante Links:
Ins Deutsche übersetzte Romane und hier rezensiert:
Er schrieb zudem Sharebon (humorvolle Geschichten über die Freudenviertel), eine Literaturgattung die während der Kansei-Reformen verboten wurde. Als Kyoden Santo 1791 drei Sharebon veröffentlichte, wurde er zur Strafe für 50 Tage in Handschellen gelegt. Er verlegte sich im Anschluss mehr auf die Literaturgattung Yomihon (romanhafte, moralisch geprägte Lesebücher, die an historische Gegebenheiten der chinesischen und japanischen Geschichte angelehnt sind; mehr Assemblage als originäre Schöpfung).
Zeitweise führte Kyoden Santo untertags einen Tabakladen, die Nächte streifte er durch Tokios Freudenviertel Yoshiwara. So kaufte er auch seine Lieblingskurtisane frei und nahm sie zur Zweitfrau.
1816 starb der Autor.
Interessante Links:
- The Samurai Archives/SamuraiWiki: Biographie von Kyoden Santo
- Google Books: „Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900“ von Professor Haruo Shirane
Ins Deutsche übersetzte Romane und hier rezensiert:
Samstag, 10. November 2012
„Der Schlüssel“ von Junichiro Tanizaki
„Der Schlüssel“ für das Schränkchen, in dem der Professor sein Tagebuch verwahrt, liegt eines Tages wie als eine Aufforderung an des Professors Ehefrau auf dem Schreibtisch. Die Ehefrau Ikuko soll im Tagebuch lesen, denn hier zeichnet der Professor Pikantes auf: Das sexuelle Eheleben der beiden ist alles andere als erfüllt und so schreibt der Professor in seinem Tagebuch von seinen Wünschen, Fantasien und seinen Mitteln, mit denen er seine Begierde stillen kann.
In „Der Schlüssel“ versammeln sich allerhand Fetische: Der Professor liebt es, die Füße seiner Ehefrau zu liebkosen, ihren nackten Körper bis ins letzte Detail zu betrachten, sie in diverse Positionen zu bringen und dann zu fotografieren. Da Ikuko konservativ eingestellt ist und seinen sexuellen Wünschen nicht freiwillig nachkommen will, muss sich der Professor eine List ausdenken, um auf seine Kosten zu kommen: Regelmäßig hält er seine Ehefrau zu ausgiebigem Alkoholkonsum an. Betrunken und wehrlos kann er mit ihr tun und lassen, was er will.
Doch der Professor will mehr als er kann: Er muss sich bereits Hormonspritzen setzen lassen, um sexuell aktiv sein zu können. Und er bedient sich noch eines anderen Aphrodisiakums – der Eifersucht. Der junge Kimura war eigentlich als Bräutigam für die gemeinsame Tochter ausersehen. Doch Kimura und Ikuko fühlen sich weit mehr angezogen. Der Professor missbilligt dies nicht, er berauscht sich sogar an dem Gefühl der Eifersucht.
In Tagebuchaufzeichnungen hält der Professor die Geschehnisse fest. Doch auch Ikuko beginnt, ein Tagebuch zu führen. Ob die beiden heimlich die Tagebücher des anderen lesen und so ihre Handlungen und Niederschriften taktisch ausrichten?
Die wahre Abgründigkeit von Junichiro Tanizakis Roman tritt erst gegen Ende vollkommen zu Tage. Wie in anderen Tanizaki-Werken ist der Protagonist seiner Angebeteten bis zur masochistischen Selbstaufgabe vollkommen verfallen. Die dunkle Seite der Sexualität zieht den Leser auch Jahre nach der Veröffentlichung in den Bann, auch wenn der eigentliche Akt nur andeutungsweise geschildert wird.
Bibliographische Angaben:
Tanizaki, Junichiro: „Der Schlüssel“, Rowohlt, Reinbek 1961
In „Der Schlüssel“ versammeln sich allerhand Fetische: Der Professor liebt es, die Füße seiner Ehefrau zu liebkosen, ihren nackten Körper bis ins letzte Detail zu betrachten, sie in diverse Positionen zu bringen und dann zu fotografieren. Da Ikuko konservativ eingestellt ist und seinen sexuellen Wünschen nicht freiwillig nachkommen will, muss sich der Professor eine List ausdenken, um auf seine Kosten zu kommen: Regelmäßig hält er seine Ehefrau zu ausgiebigem Alkoholkonsum an. Betrunken und wehrlos kann er mit ihr tun und lassen, was er will.
Doch der Professor will mehr als er kann: Er muss sich bereits Hormonspritzen setzen lassen, um sexuell aktiv sein zu können. Und er bedient sich noch eines anderen Aphrodisiakums – der Eifersucht. Der junge Kimura war eigentlich als Bräutigam für die gemeinsame Tochter ausersehen. Doch Kimura und Ikuko fühlen sich weit mehr angezogen. Der Professor missbilligt dies nicht, er berauscht sich sogar an dem Gefühl der Eifersucht.
In Tagebuchaufzeichnungen hält der Professor die Geschehnisse fest. Doch auch Ikuko beginnt, ein Tagebuch zu führen. Ob die beiden heimlich die Tagebücher des anderen lesen und so ihre Handlungen und Niederschriften taktisch ausrichten?
Die wahre Abgründigkeit von Junichiro Tanizakis Roman tritt erst gegen Ende vollkommen zu Tage. Wie in anderen Tanizaki-Werken ist der Protagonist seiner Angebeteten bis zur masochistischen Selbstaufgabe vollkommen verfallen. Die dunkle Seite der Sexualität zieht den Leser auch Jahre nach der Veröffentlichung in den Bann, auch wenn der eigentliche Akt nur andeutungsweise geschildert wird.
Bibliographische Angaben:
Tanizaki, Junichiro: „Der Schlüssel“, Rowohlt, Reinbek 1961
Mittwoch, 7. November 2012
„Chrysanthemen-Ball“ von Ryunosuke Akutagawa
Ryunosuke Akutagawa entführt mit seinen Erzählungen im Band „Chrysanthemen-Ball“ zum Teil in ein exotisches Japan der Vormoderne. Die längste Erzählung und sicherlich Highlight des Bandes „Die Qualen der Hölle“ (identisch mit „Der Höllenschirm“ in „Drachen und tote Gesichter“) spielt am Hof eines Fürsten: Yoshihide ist ein besonders eigensinniger Maler, der vom Fürsten beauftragt wird, einen Wandschirm mit einer Darstellung der Hölle zu bemalen. Yoshihide kann jedoch nur malen, was er in Realität gesehen hat. So hat er bereits verwesende Leichen am Objekt studiert und skizziert. Seine Assistenten müssen einige Grausamkeiten erleiden, damit Yoshihide ein naturgetreues Modell zu sehen bekommt. Währenddessen weilt seine Tochter am Hof des Fürsten und bezaubert mit ihrem Wesen und ihrer Schönheit. Als Yoshihide jedoch eine Schaffenskrise erleidet, wird auch die Harmonie am Hof gestört.
Auch „Die Pfeife“ spielt in adeligen Kreisen. Der Feudalherr Narihiro ist besonders stolz auf seine goldene Pfeife, die ihm die Samurai sehr neiden. Zwei der Samurai setzen sich zum Ziel, Narihiro die Pfeife abzuluchsen.
„Die Nase“, eine Erzählung, die unter Anleitung von Soseki Natsume entstand, schildert mit Augenzwinkern das Schicksal eines Abtes, der unter seiner ganz besonders langen Nase leidet.
In der Moderne spielen die Erzählungen und Kurzgeschichten „Apfelsinen“, „Der Chrysanthemen-Ball“, „Professor Mori“ und „Der Verdacht“.
„Apfelsinen“ illustriert eine Eisenbahnfahrt des Ich-Erzählers. Eine junge Landpomeranze verirrt sich von der dritten in die zweite Klasse und ärgert den Protagonisten mit ihrem Verhalten – zunächst…
„Der Chrysanthemen-Ball“ ist der erste Ball europäischer Art für die junge Aiko. Ein Franzose ist sehr verzaubert von der japanischen Schönheit und wird ihr ein Denkmal setzen.
An „Professor Mori“ erinnert sich der Ich-Erzähler: Sein alter, unfähiger Englischlehrer, der einfach nicht vom Unterrichten lassen kann.
In „Der Verdacht“ erhält der Ich-Erzähler einen seltsamen Besuch: Ein Mann will sich das Herz erleichtert, indem er von seinem Schicksal berichtet. Während eines Erdbebens wurde seine Ehefrau unter einem Hausbalken begraben. Unfähig, sie aus den brennenden Trümmern zu befreien, schlägt er sie lieber tot, als sie einen Tod im Feuer erleiden zu sehen. Doch die Schuldgefühle rauben ihm fast den Verstand.
Bibliographische Angaben:
Akutagawa, Ryunosuke: „Chrysanthemen-Ball“, Nymphenburger, München 1964
Auch „Die Pfeife“ spielt in adeligen Kreisen. Der Feudalherr Narihiro ist besonders stolz auf seine goldene Pfeife, die ihm die Samurai sehr neiden. Zwei der Samurai setzen sich zum Ziel, Narihiro die Pfeife abzuluchsen.
„Die Nase“, eine Erzählung, die unter Anleitung von Soseki Natsume entstand, schildert mit Augenzwinkern das Schicksal eines Abtes, der unter seiner ganz besonders langen Nase leidet.
In der Moderne spielen die Erzählungen und Kurzgeschichten „Apfelsinen“, „Der Chrysanthemen-Ball“, „Professor Mori“ und „Der Verdacht“.
„Apfelsinen“ illustriert eine Eisenbahnfahrt des Ich-Erzählers. Eine junge Landpomeranze verirrt sich von der dritten in die zweite Klasse und ärgert den Protagonisten mit ihrem Verhalten – zunächst…
„Der Chrysanthemen-Ball“ ist der erste Ball europäischer Art für die junge Aiko. Ein Franzose ist sehr verzaubert von der japanischen Schönheit und wird ihr ein Denkmal setzen.
An „Professor Mori“ erinnert sich der Ich-Erzähler: Sein alter, unfähiger Englischlehrer, der einfach nicht vom Unterrichten lassen kann.
In „Der Verdacht“ erhält der Ich-Erzähler einen seltsamen Besuch: Ein Mann will sich das Herz erleichtert, indem er von seinem Schicksal berichtet. Während eines Erdbebens wurde seine Ehefrau unter einem Hausbalken begraben. Unfähig, sie aus den brennenden Trümmern zu befreien, schlägt er sie lieber tot, als sie einen Tod im Feuer erleiden zu sehen. Doch die Schuldgefühle rauben ihm fast den Verstand.
Bibliographische Angaben:
Akutagawa, Ryunosuke: „Chrysanthemen-Ball“, Nymphenburger, München 1964
Montag, 5. November 2012
Ryunosuke Akutagawa
 |
| Ryunosuke Akutagawa |
1892 in Tokio geboren war es ihm nicht vergönnt, von seiner leiblichen Mutter Fuku Nihara, einer geborenen Akutagawa, aufgezogen zu werden. Kurz nach seiner Geburt brach eine schwere Psychose bei der Mutter aus. Ihr Sohn wurde von ihrem Bruder aufgezogen und nahm damit auch den Nachnamen Akutagawa an. Den Vornamen Ryunosuke (= Drachensohn) erhielt er, da er im Jahr, im Monat, am Tag und – angeblich – auch in der Stunde des Drachen geboren wurde.
Er war schon früh an Literatur von Ogai Mori und Soseki Natsume interessiert. 1913 begann er, Anglistik an der kaiserlichen Universität von Tokio zu studieren. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst als Englischlehrer.
Sein Wunsch, eine Jugendfreundin zu heiraten, scheiterte am Widerstand seiner Familie. 1918 heiratete er Fumi Tsukamoto, mit der er drei Kinder hatte.
1914 publizierte er noch als Student seine erste Kurzerzählung „Rashomon“, die später von Akira Kurosawa verfilmt werden sollte. Soseki Natsume wurde nach der Veröffentlichung auf Akutagawa aufmerksam. Soseki Natsume fungierte fortan als Mentor für den jungen Autor. Die Erzählung „Die Nase“ resultierte aus gemeinsamen Treffen.
Ryunosuke Akutagawa lehnte den Naturalismus ab, den die Leser ebenfalls müde waren. Oscar Benl beschreibt im Nachwort des Bandes „Chrysanthemen-Ball“ Akutagawas Stil wie folgt:
„So fand Akutagawa, dem die künstlerische Gestaltung wichtiger als das Material, die ausgewogene Form schöner als Empfindungen und Bekenntnisse erschien, den Boden für sich bereitet. Er bezauberte weithin durch sein Formgefühl.“ (S. 149)
Mit seinem Fokus auf die Form stand Akutagawa in Opposition zum Stil von Junichiro Tanizaki.
Mitte der 20er Jahre brach genauso wie bei seiner Mutter auch bei Ryunosuke Akutagawa eine psychische Störung auf. 1927 versuchte er ein erstes Mal vergebens, sich das Leben zu nehmen. Im selben Jahr nahm er eine Überdosis Veronal ein, die er von seinem Hausarzt Mokichi Saito erhalten hatte, und verstarb.
Der Autor Kan Kikuchi, der seit Schulzeiten mit Ryunosuke Akutagawa befreundet war, rief 1935 zu Ehren seines Freundes den Akutagawa-Literaturpreis aus, mit dem Nachwuchsschriftsteller ausgezeichnet werden.
Interessante Links:
- The Japan Times: Ryunosuke Akutagawa in focus
- Yahoo! Voices: Ryunosuke Akutagawa: Japan’s Father of the Short Story
- Goodreads: Zitate von Ryunosuke Akutagawa
Hier rezensiert:
Weitere ins Deutsche übersetzte Erzählungen/Kurzgeschichten:
- Die Fluten des Sumida
- Die Geschichte einer Rache
- Japanische Novellen
- Rashomon
Sonntag, 4. November 2012
„Gyokusai“ von Makoto Oda
„Ein trefflicher Mann sollte besser ein zerspringender Edelstein werden, als sich einem gewöhnlichen Dachziegel gleichzumachen, nur weil dieser unversehrt bleibt.“
(Nachwort von Michaela Manke, S. 134 in Bezug auf die „Geschichte des Nördlichen Qi“ von Li Baiyao, 7. Jahrhundert)
Der Begriff „Gyokusai“ steht im Japanischen für den zerspringenden Edelstein – und während den letzten Zügen des Pazifikkriegs für den sicherlich fraglichen Heldentod von japanischen Soldaten, die gegen die übermächtigen US-amerikanischen Gegner anrannten. In Kriegsgefangenschaft zu geraten stand nicht zu Debatte – eher sollten sich die Soldaten mit einer Handgranate selbst töten, bevor sie sich dem Gegner schmachvoll ergeben. Neben der unbedingten Gehorsam laut der Konfuzianischen Ethik, dem Verbot des Sich-Ergebens laut dem Militärhandbuch tat der Staatshintoismus sein Übriges: In einem Totenkult wurden gefallenen Soldaten seit 1879 im Yaskukuni-Schrein verehrt.
Makoto Oda versetzt den Leser mit „Gyokusai“ direkt in die grausame Zeit des Pazifikkriegs. Gruppenführer Nakamura wird mit den ihm unterstellten Soldaten auf eine kleine Pazifikinsel, die Leyte vorgelagert ist, versetzt. Die Weisung lautet: „Mit dem eigenen Leib ein Wellenbrecher im Pazifik!“ Die Aussichtslosigkeit der Lage geht aus der Losung bereits hervor – der US-amerikanischen Übermacht kann man nur noch den bloßen Körper entgegen werfen.
Nakamura und seine Gruppe rüsten sich für den Angriff der Amerikaner und bauen Inselhöhlen aus, um sie als Rückzugsmöglichkeiten zu nutzen. Doch eigentlich wollen sie nicht bauen, sondern kämpfen. Als die ersten feindlichen Truppen landen, zeigt sich bereits deren Übermacht – den Japanern bleibt nur ein Partisanenkrieg zur Verteidigung der Insel. Doch gegen die gut ausgerüstete amerikanische Armee können die Japaner nur veraltete Gewehre einsetzen. Und die Kugeln werden mit der Zeit knapp. Von Angriff zu Angriff dezimiert sich die Gruppe, die Nakamura um sich schart. Die Amerikaner gehen zum Gegenangriff über und räuchern die Japaner in den Höhlen aus, lassen sie dort bei lebendigem Leib verbrennen.
Der Gedanke an einen japanischen Sieg ist den Soldaten bereits längst abhanden gekommen. Doch ergeben können sie sich nicht – sie wollen im Kampf ehrenvoll sterben. Selbst Flugblätter der Amerikaner können kein Umdenken bewirken.
Trotz aller Grausamkeit beschreibt Makoto Oda die Geschehnisse distanziert. Die Soldaten erscheinen nicht verzweifelt, sondern haben auf ihre Art bereits mit dem Leben abgeschlossen, resigniert. Damit geht die Tonalität kongruent.
Interessant an „Gyokusai“ ist zudem die Thematisierung der Diskriminierung von Koreanern: Nakamura wird der koreanische Unterfeldwebel Kon zur Seite gestellt. Im Heimatland Korea ist ihm seine Muttersprache verwehrt, er muss japanisch sprechen, soll sich als Japaner fühlen. Doch die Japaner sehen ihn nicht als Japaner, obwohl er Seite an Seite mit ihnen kämpft. Und auch eine japanische Prostituierte weiß von Koreanerinnen zu berichten, die als Trostfrauen zwangsrekrutiert wurden.
Im Nachwort geht Michaela Manke darauf ein, ob das Phänomen des Gyokusai denn ein ausschließlich japanisches sei. Denn schließlich gab es auch während des zweiten Weltkriegs in Deutschland den Begriff des Heldentods. Ist es nicht vielmehr so, dass der Wahnsinn des Kriegs Menschen ganz unabhängig von der Nationalität in den Tod treibt? Auch Nakamura und Kon sind im Grunde ganz normale Menschen – in einer ganz anormalen Situation…
Bibliographische Angaben:
Oda, Makoto: „Gyokusai“, Schiler, Berlin/Tübingen 2010, ISBN 978-3-89930-324-7
Labels:
40er,
Diskriminierung,
Gewalt,
Makoto Oda,
Militär,
Pazifikkrieg,
Rezensionen,
Tod
Samstag, 3. November 2012
Makoto Oda
Makoto Oda wurde 1932 in Osaka geboren. Ohne Wissen seiner Eltern meldete er sich 13-jährig bei der Luftwaffe zur Ausbildung zum Kamikaze-Flieger, kam aber dank des Kriegsendes nicht mehr zum Einsatz. Beeinflusst durch seine eigenen Kriegserlebnisse in Japan und den Koreakrieg begann Makoto Oda Anfang der 50er Jahre zu schreiben und veröffentlichte sein erstes Werk.
Der Autor studierte griechische Philosophie und Literatur und ging 1958 mit einem Fulbright-Stipendium in die USA, um in Harvard weiter zu studieren. Sein 1961 veröffentlichter Roman, der seine Reisen durch die USA und Europa bei einem täglichen Budget von einem Dollar beschreibt, wurde ein Bestseller. Er veröffentlichte unzählige Essays, insgesamt mehr als 100 Bücher einschließlich um die 30 Romane.
Zusammen mit Shunsuke Tsurumi und Takeshi Kaiko begründete er die Anti-Vietnamkriegsbewegung Beheiren. Als 2004 eine Verfassungsänderungen diskutiert wurde, gründete er unter anderem zusammen mit Kenzaburo Oe und Shuichi Kato den „Verein für den Verfassungsartikel 9“, der den Verzicht Japans auf das Recht auf Krieg regelte.
2007 starb Makoto Oda an Magenkrebs.
Interessante Links:
Ins Deutsche übersetzte Romane/Erzählungen und hier rezensiert:
Der Autor studierte griechische Philosophie und Literatur und ging 1958 mit einem Fulbright-Stipendium in die USA, um in Harvard weiter zu studieren. Sein 1961 veröffentlichter Roman, der seine Reisen durch die USA und Europa bei einem täglichen Budget von einem Dollar beschreibt, wurde ein Bestseller. Er veröffentlichte unzählige Essays, insgesamt mehr als 100 Bücher einschließlich um die 30 Romane.
Zusammen mit Shunsuke Tsurumi und Takeshi Kaiko begründete er die Anti-Vietnamkriegsbewegung Beheiren. Als 2004 eine Verfassungsänderungen diskutiert wurde, gründete er unter anderem zusammen mit Kenzaburo Oe und Shuichi Kato den „Verein für den Verfassungsartikel 9“, der den Verzicht Japans auf das Recht auf Krieg regelte.
2007 starb Makoto Oda an Magenkrebs.
Interessante Links:
- Offizielle Homepage von Makoto Oda (leider nur auf japanisch)
- Japan Focus: Oda Makoto, Beheiren and 14 August 1945: Humanitarian wrath against indiscriminate bombing
Ins Deutsche übersetzte Romane/Erzählungen und hier rezensiert:
Freitag, 2. November 2012
„Wiedersehen mit Osaka“ von Miyuki Tsuji
Von der Elbe an den Yodo – und wieder zurück. „Wiedersehen mit Osaka“ beginnt in Hamburg, der neuen, zweiten Heimat der Autorin Miyuki Tsuji und endet in Osaka in Gedanken an die Hansestadt. Hat sich die Autorin gerade deshalb in Hamburg niedergelassen, da es Osaka in der Lage am Meer und der Funktion als Handelsstadt gleicht – man kann nur mutmaßen.
Miyuki Tsuji führt den Leser in das Osaka aus drei Perioden: Das Osaka, in dem ihre Großmutter in den 20ern war, das Osaka, durch das sie als Kind zusammen mit der Großmutter gestreift ist, und das Osaka, in das sie zurückkehrt, um ihre Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Auf Spaziergängen forscht sie nach den Plätzen, die sie als Kind besucht hat und die zwischenzeitlich großstädtischen Veränderungen unterworfen waren. Sie berichtet aus dem Leben der Großmutter, die sich als fortschrittliche Frau einer arrangierten Ehe verweigerte und nur kurze Zeit ihr Glück in einer Liebesheirat fand. Von ihrem Großvater, der einen Hang zu verrückten Erfindungen hatte. Von ihrem Vater, der nicht das Gefühl hatte, von seiner Mutter geliebt zu werden.
Doch „Wiedersehen mit Osaka“ bietet auch diverse Hintergrundinformationen zu Osaka und zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten Osakas und wird damit zudem zu einem kleinen Reiseführer: So wird die Entstehung von Osaka skizziert und die Rolle der Kaufmannsfamilien, die das Stadtbild durch Kanalbau geprägt haben. Ein Besuch der Burg von Osaka lässt die Autorin von den historischen Geschehnissen des 17. Jahrhunderts berichten, als die Konkubine des Feldherrn Hideyoshi zusammen mit dem gemeinsamen Sohn dort Selbstmord verübte. Der Leser erfährt mehr über das Bunraku-Puppentheater, dessen Stücke durch reale, unglückliche Liebschaften in Osakas Teehäusern inspiriert wurden. Und es wird über den Autor Junichiro Tanizaki berichtet, der zeitweise in Osaka lebte, sich in eine Kaufmannsehefrau verguckte und mit Erzählungen wie „Die Biografie der Frühlingsharfe“ und „Die Erzählung eines Blinden“ (jeweils zu finden in „Die Traumbrücke“) Osaka ein literarisches Vermächtnis setzte.
„Wiedersehen mit Osaka“ zeichnet ein wunderschön-persönliches Bild der Stadt und fungiert gleichzeitig wie ein kompetenter Stadtführer. Mehr davon, bitte!
Bibliographische Angaben:
Tsuji, Miyuki: „Wiedersehen mit Osaka", Wiesenburg Verlag, Schweinfurt 2008, ISBN 978-3-937-10177-4
Miyuki Tsuji führt den Leser in das Osaka aus drei Perioden: Das Osaka, in dem ihre Großmutter in den 20ern war, das Osaka, durch das sie als Kind zusammen mit der Großmutter gestreift ist, und das Osaka, in das sie zurückkehrt, um ihre Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Auf Spaziergängen forscht sie nach den Plätzen, die sie als Kind besucht hat und die zwischenzeitlich großstädtischen Veränderungen unterworfen waren. Sie berichtet aus dem Leben der Großmutter, die sich als fortschrittliche Frau einer arrangierten Ehe verweigerte und nur kurze Zeit ihr Glück in einer Liebesheirat fand. Von ihrem Großvater, der einen Hang zu verrückten Erfindungen hatte. Von ihrem Vater, der nicht das Gefühl hatte, von seiner Mutter geliebt zu werden.
Doch „Wiedersehen mit Osaka“ bietet auch diverse Hintergrundinformationen zu Osaka und zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten Osakas und wird damit zudem zu einem kleinen Reiseführer: So wird die Entstehung von Osaka skizziert und die Rolle der Kaufmannsfamilien, die das Stadtbild durch Kanalbau geprägt haben. Ein Besuch der Burg von Osaka lässt die Autorin von den historischen Geschehnissen des 17. Jahrhunderts berichten, als die Konkubine des Feldherrn Hideyoshi zusammen mit dem gemeinsamen Sohn dort Selbstmord verübte. Der Leser erfährt mehr über das Bunraku-Puppentheater, dessen Stücke durch reale, unglückliche Liebschaften in Osakas Teehäusern inspiriert wurden. Und es wird über den Autor Junichiro Tanizaki berichtet, der zeitweise in Osaka lebte, sich in eine Kaufmannsehefrau verguckte und mit Erzählungen wie „Die Biografie der Frühlingsharfe“ und „Die Erzählung eines Blinden“ (jeweils zu finden in „Die Traumbrücke“) Osaka ein literarisches Vermächtnis setzte.
„Wiedersehen mit Osaka“ zeichnet ein wunderschön-persönliches Bild der Stadt und fungiert gleichzeitig wie ein kompetenter Stadtführer. Mehr davon, bitte!
Bibliographische Angaben:
Tsuji, Miyuki: „Wiedersehen mit Osaka", Wiesenburg Verlag, Schweinfurt 2008, ISBN 978-3-937-10177-4
Donnerstag, 1. November 2012
Miyuki Tsuji
Miyuki Tsuji (geboren 1968 in Osaka) studierte Slavistik und Kunst in Tokio. Sie ging nach Europa, wo sie zunächst in Polen studierte und schließlich in Hamburg eine neue Heimat fand. Zunächst veröffentlichte sie ihre Reiseerinnerungen in einer japanischen Zeitschrift. Anschließend schrieb sie auch für deutsche Zeitschriften und Zeitungen.
Miyuki Tsuji zeichnet zudem für die Übersetzung der japanischen Manga-Serie „Naruto“ ins Deutsche verantwortlich. Zusammen mit dem Illustrator Baron Malte (aka Malte von Thiesenhausen) veröffentlichte sie zwei Manga-Bände, die die Geschichte der Ninja zum Inhalt haben.
Interessante Links:
Auf Deutsch verfasste Essays und hier rezensiert:
Miyuki Tsuji zeichnet zudem für die Übersetzung der japanischen Manga-Serie „Naruto“ ins Deutsche verantwortlich. Zusammen mit dem Illustrator Baron Malte (aka Malte von Thiesenhausen) veröffentlichte sie zwei Manga-Bände, die die Geschichte der Ninja zum Inhalt haben.
Interessante Links:
Auf Deutsch verfasste Essays und hier rezensiert:
Abonnieren
Posts (Atom)